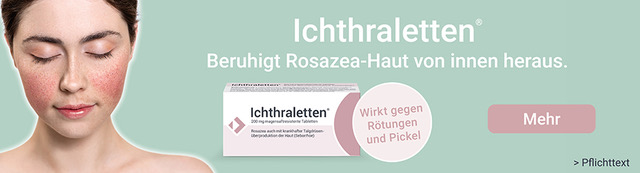Das Auge kann bei der Rosazea durch die Nähe der Augenoberfläche zum Organ Haut betroffen werden. In Form der sogenannten okulären Rosacea kann es sogar erster und alleiniger Ort einer Manifestation ohne eine weitere Hautbeteiligung sein.
Das Auge kann bei der Rosazea durch die Nähe der Augenoberfläche zum Organ Haut betroffen werden. In Form der sogenannten okulären Rosacea kann es sogar erster und alleiniger Ort einer Manifestation ohne eine weitere Hautbeteiligung sein.Häufigkeit
Die Rosazea ist eine sehr weit verbreitete Hauterkrankung. Bis zu 13 Millionen US-Amerikaner sollen von ihr betroffen sein. Darunter finden sich wiederum in 8-50% Patienten mit einer offensichtlichen Augenbeteiligung. In bis zu 90% der Betroffenen soll jedoch eine weniger offensichtliche Lidbeteiligung, die so genannte Meibomdrüsendysfunktion (MDD) zu beobachten sein.
Krankheitsentstehung
Die sog. Meibom-Drüsen, sind die Talgdrüsen der Lidkanten. Ca. 70 dieser Drüsen finden sich in Ober- und Unterlid jedes Auges. Ihr fetthaltiges Sekret, das „Meibum“, ist für einen stabilen Tränenfilm und damit für die Ernährung und den Schutz der Augenoberfläche von wesentlicher Bedeutung. Bei der MDD führt eine erhöhte Konzentration von Triglyzeriden und freien Fettsäuren zur Freisetzung von Botenstoffen, die eine Entzündungsreaktion in Form der Einwanderung von Entzündungszellen in das Augenlid auslöst.
 Bei länger und schwerer Erkrankung kommt es zur Mitbeteiligung der Binde- und Hornhaut. Die Lidentzündung ist verbunden mit einer Veränderung der regulären bakteriellen Besiedlung der Lidkante. Diese pathologische Bakterienbesiedlung zerstört die Fettanteile des Tränenfilms weiter. Zusätzlich wurde eine Besiedlung der Lidkanten mit Milben (Demodex folliculorum) als Auslöser für eine Rosazea vermutet.
Bei länger und schwerer Erkrankung kommt es zur Mitbeteiligung der Binde- und Hornhaut. Die Lidentzündung ist verbunden mit einer Veränderung der regulären bakteriellen Besiedlung der Lidkante. Diese pathologische Bakterienbesiedlung zerstört die Fettanteile des Tränenfilms weiter. Zusätzlich wurde eine Besiedlung der Lidkanten mit Milben (Demodex folliculorum) als Auslöser für eine Rosazea vermutet.Krankheitszeichen
Betroffen klagen gehäuft über brennende Augen und gerötete Lidkanten.
Dies kann mit einem unfreiwilligen Tränenträufeln verbunden sein. Oft werden verkrustete oder schuppige Lidränder beobachtet.
 Die Beschwerden sind häufig morgens besonders stark und bessern sich im Tagesverlauf. Wenn die Rosazea zusätzlich zur Ausbildung eines trockenen Auges geführt hat kann es im Tagesverlauf zu einem zunehmenden Fremdkörper- und Trockenheitsgefühl kommen.
Die Beschwerden sind häufig morgens besonders stark und bessern sich im Tagesverlauf. Wenn die Rosazea zusätzlich zur Ausbildung eines trockenen Auges geführt hat kann es im Tagesverlauf zu einem zunehmenden Fremdkörper- und Trockenheitsgefühl kommen.Bei der augenärztlichen Untersuchung finden sich frühzeitig Veränderungen in der Zusammensetzung die zu einer Schaumbildung des Tränenfilms führt. Das sonst klare Meibomdrüsensekret wird trüb und verhärtet zunehmend.
Am Lidrand finden sich Blutgefäßerweiterungen und bei chronischer Entzündung dauerhafte Veränderung wie eine Abrundung oder narbige Verziehung der Lidkante bis hin zum Verschluss der Meibomdrüsenöffnungen.
 Es werden gehäuft Hagelkörner (Chalazion) beobachtet. Die Tränenfilmveränderung und Lidrandentzündung ist häufig mit einer Bindehautentzündung und seltener schweren Hornhautbeteiligungen wie z. B. Geschwürbildung und Verdünnung verbunden. Schwere, dauerhafte Sehminderung sind jedoch sehr selten.
Es werden gehäuft Hagelkörner (Chalazion) beobachtet. Die Tränenfilmveränderung und Lidrandentzündung ist häufig mit einer Bindehautentzündung und seltener schweren Hornhautbeteiligungen wie z. B. Geschwürbildung und Verdünnung verbunden. Schwere, dauerhafte Sehminderung sind jedoch sehr selten.Therapie
Die Therapie der Erkrankung umfasst zum einen eine lokale Behandlung der Lidveränderungen direkt, als auch eine allgemeine Behandlung der Grunderkrankung.
Als Standardmaßnahmen gelten heute
- Liderwärmung und –reinigung
- Antibiotika
- Entzündungshemmende Medikamente
- Tränenersatzmittel
Liderwärmung und –reinigung
Durch eine mindestens 4-5-minütige Erwärmung der Lider wird das Fettsekret der Meibomdrüsen verflüssigt und kann so aus den Lidern massiert werden. Dabei ist wichtig, dass die Erwärmung effizient erfolgt und die Massage der Lider jeweils dem Verlauf der Drüsen entsprechend zum Auge hin erfolgt (Oberlid von oben nach unten, Unterlid von unten nach oben). Krustige Beläge sollten von den Lidkanten mit Hilfe z. B. von Babyshampoo, Natronlauge oder abgekochtem Wasser und Wattestäbchen entfernt werden. Der Ablauf sollte zweimal täglich und über mindestens 3 Monate durchgeführt werden. Für die Liderwärmung und -reinigung stehen mittlerweile einige Reinigungs- und andere Hilfsmittel zur Verfügung.
Antibiotika
Antibiotika (Metronidazol, Azythromyzin u .a.) sind nicht nur bei offensichtlicher Infektion, sondern auf Grund zusätzlicher entzündungshemmender und fettverflüssigender Wirkmechanismen auch bei chronischem, nicht-infektiösem Verlauf sinnvoll. Eine Wirksamkeit ist insbesondere für systemisch angewandte Tetrazyklinderivate belegt worden. Auch diese Therapie muss für mindestens 3 Monate angewendet werden, um eine nachhaltige Besserung der Situation zu erzielen. Bei jeder Medikamentenanwendung sind unerwünschte Wirkungen, wie z. B. allergische Reaktionen oder wie im Fall von Tetrazyklinderivaten eine Lichtüberempfindlichkeitsreaktion zu beachten.
Entzündungshemmende Medikamente
Bei schweren entzündlichen Veränerungen werden Kortisonhaltige Augentropfen und –salben angewendet. Diese führen fast immer zu einer raschen Besserung währender der Anwendung. Nach Therapieende kommt es jedoch häufig wieder zu einer Verschlechterung. Auf Grund von Nebenwirkungen wie der Entstehung eines grauen oder grünen Stars sollte Kortison am Auge nur vorübergehend angewendet werden. Neue Kortison-ersetzende Augenmedikamente (z. B. Ciclosporin), die auch bei langer Anwendung diese Nebenwirkungen nicht haben, sind noch in der Entwicklungsphase.
Tränenersatz
Zur symptomatischen Linderung der Beschwerden des oft gleichzeitig bestehenden trockenen Auges können Tränenersatzmittel angewendet werden. Von den vielen vorhandenen Präparaten sollte bei mehr als 2-3x täglicher Anwendung ein unkonserviertes Präparat verwendet werden.
In letzter Zeit wurden zusätzlich diätetische Maßnahmen aber auch eine Sondierung der Meibomdrüsen, die Gegenstand aktueller wissenschaftlicher Untersuchungen sind. Bei Komplikationen, wie z. B. Hornhautschäden oder gröberen Lidveränderungen wird aber auch z. B. mit Kontaktlinsen oder operativen Eignriffen behandelt. Während in einer akuten Entzündungsphase insbesondere entzündungshemmende Medikamente (z. B. Kortisonsalben) schnell Linderung bringen erfordert die chronische Natur der Erkrankung oft Geduld, bis eine Besserung der auslösenden Faktoren und eine langfristige Stabilisierung erreicht ist.
Wer kann helfen und wie geht es langfristig weiter?
Bei entsprechenden Symptomen sollte ein Augenarzt aufgesucht werden, um ggf. andere Ursachen auszuschließen, auch wenn eine Rosazea vielleicht bereits durch einen Hautarzt diagnostiziert und eine Behandlung eingeleitet wurde. Im Falle der Erstdiagnose durch en Augenarzt sollte wiederum eine Vorstellung beim Hautarzt zum Ausschluss weiterer Beteiligungen im Bereich der Haut und ggf. zur Therapieabstimmung erfolgen. Bei einer rein okulären Roszea darf jedoch durch den Hautarzt keine Bestätigung der Diagnose erwartet werden. In diesem Fall wird die Behandlung führend durch den Augenarzt erfolgen müssen. Im Idealfall übernehmen Haut- und Augenarzt die Behandlung gemeinsam. Wichtig ist, dass Betroffene einen kompetenten Ansprechpartner finden. Dieser wird immer über die chronische Natur der Erkrankung aber auch über die Vielzahl der Behandlungsmöglichkeiten informieren, so dass betroffene Patienten zum einen eine realistische Einschätzung über den Verlauf der Erkrankung entwickeln, andererseits sich aber auch nicht alleingelassen fühlen.
Die Augenklinik der Universität Düsseldorf hat weiter wie gehabt eine Spezialsprechstunde eigens für die Betreuung von Patienten mit entzündlichen Augenoberflächenerkrankungen. Hier haben Betroffene mit primärer oder sekundärer Augenbeteiligung bei trockenem Auge, Rosazea, Graft-versus-Host-Disease, Stevens-Johnson-Syndrom oder okuläres Schleimhautpemphigoid Zugang zu allen aktuellen diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten und erhalten eine ggf. ausführliche Beratung.
Spezialsprechstunde für Augenoberflächenerkrankungen
 Über den Autor:
Über den Autor:Prof. Dr. G. Geerling ist Leiter der Universitätsaugenklinik Düsseldorf
(Moorenstraße 5, 40225 Duesseldorf http://www.uniklinik-duesseldorf.de/augenklinik