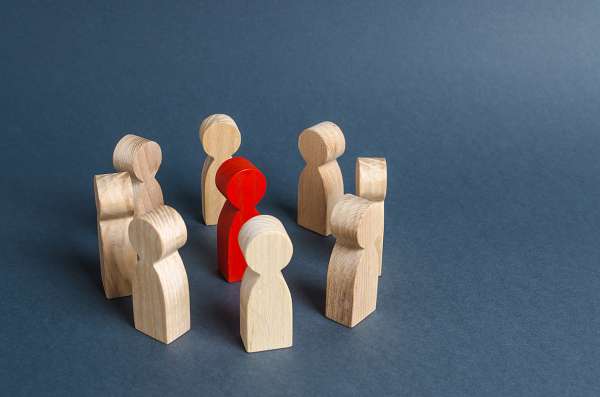Die
Haut: Mit 1,5 bis 2 qm ist sie das größte Organ unseres Körpers. Haut
und Nervensystem werden aus dem gleichen Keimblatt „geboren“. Ist das
ein Grund dafür, dass die Haut als Spiegel unserer Seele gilt?
So mancher Dünnhäuter wünscht sich, ein Dickhäuter zu sein. Wenn
Konflikte unter die Haut gehen, kann das nämlich direkt zu entzündlichen
Prozessen in der Haut führen. Warum das so ist und wie die Psychodermatologie helfen kann, hat Univ.-Prof. Dr. med. Uwe Gieler, kommissarischer Leiter der Hautklinik Gießen, unserer Redakteurin Sonja Kohn erklärt.
Herr Prof. Gieler, warum braucht es heute die Psychodermatologie?
Gieler: Die Psychodermatologie ist inzwischen eine wichtige
Subdisziplin der Dermatologie geworden, weil wir immer wieder Menschen
sehen, die durch psychische Prozesse, durch Stress, durch Veränderungen
mit der Haut Probleme bekommen. Oder die sich stigmatisiert fühlen, weil
sie eine Hauterkrankung haben. Die Psychodermatologie geht diesen
Problemen nach und ist deshalb ein inzwischen etabliertes Teilgebiet der
Dermatologie.
Ist die herkömmliche Dermatologie überhaupt noch zeitgemäß?
Gieler: Natürlich ist die normale Dermatologie zeitgemäß, weil das Fach
Dermatologie, also die Beschäftigung mit den Hauterkrankungen, sich
dramatisch entwickelt hat und in den letzten Jahrzehnten zu einem sehr
modernen Fach geworden ist, was die Immunologie angeht, also die
Beschäftigung mit den Abwehrkräften der Haut. Aber es gibt natürlich
immer wieder Lücken und die Psychodermatologie gehört dazu, weil in der
Alltagsrealität der dermatologischen Versorgung unseres
Gesundheitssystems einfach nicht mehr genug Zeit ist, um mit den
Menschen, die Beschwerden haben und die an der Haut körperlich erkrankt
sind, zu klären, in wie weit auch psychische Probleme vorhanden sind.
Wie differenziere ich psychisch verursachte Hauterkrankungen von
psychosomatischen, also multifaktoriell bedingten, Hauterkrankungen?
Gieler: Indem unterschieden werden muss, ob es ursächlich an
psychischen Konflikten liegt. Also, ob ich quasi eine Störung, ein
persönliches Problem habe und deswegen eine Hautveränderung entwickle –
ich sage mal ein Beispiel: Ich habe eigentlich gar keine
Hautveränderung, aber ich stehe so unter Spannung, dass ich anfange, mir
die Haut einfach aufzukratzen – dann ist das ein psychisches Problem.
Umgekehrt kann ich eine Neurodermitis haben, die genetisch bedingt ist,
die in meiner Familie vielleicht häufiger vorkommt und die aber mir auch
Schwierigkeiten macht – und ich stelle dann doch fest, dass, immer wenn
ich in Stresssituationen bin, das Ekzem schlechter wird. Dann haben wir
einen multimodalen Zusammenhang und müssen den Stress als
Provokationsfaktor einer bestehenden Hauterkrankung ansehen. Auch
hierbei wäre eine zusätzlich zur dermatologischen Therapie sinnvolle
Psychotherapie zu empfehlen.
Welche Konflikte stecken hinter psychisch bedingten Hauterkrankungen,
wenn sich beispielsweise die Menschen selbst Verletzungen zufügen?
Gieler: Das sind in der Regel schon schwerwiegende Konflikte. Wir
können nicht davon ausgehen, dass hierbei nur kleine Alltagsprobleme
vorhanden sind, sondern das sind in der Regel doch relativ
schwerwiegende persönliche Konflikte, die mit der eigenen Entwicklung,
mit den gegenwärtigen Arbeitsbedingungen oder mit Kontakten zu anderen
Menschen zu tun haben. Menschen mit traumatischen psychischen
Erfahrungen haben beispielsweise sicher sehr schwierige und unglückliche
Situationen erlebt, die sie in eine hilflose Situation gebracht haben
und die sie selbst nicht steuern oder beeinflussen konnten. Vielleicht
in der Kindheit: Jemand wird geschlagen und findet keinen Ausweg und
keiner bemerkt das eigentlich richtig. Das sind natürlich Situationen,
die bei Selbstverletzungen nicht selten eine Rolle spielen. Hier geht es
darum, diese Situationen zu klären und mit sehr viel Feingefühl und
Sensibilität daran zu gehen, weil das natürlich auch nicht gerne erzählt
wird. Solche Dinge verschweigt man ja lieber, da sie mit Scham besetzt
sind.
Spielen solche Konflikte auch bei chronischen Hauterkrankungen eine
Rolle? Oder sind es da mehr die „Life-Events“, die eine Rolle spielen?
Gieler: Ja, es sind grundsätzlich zunächst eher die Life-Events.
Alle Studien in diesem Gebiet, die wir vorliegen haben, zeigen, dass
Lebensereignisse, die massiv sind, wie z. B. Verlust eines Partners oder
Umzug, eine Migration in ein anderes Land, dazu führen, dass sich eine
bestehende Hauterkrankung verschlechtert. In der Copenhagen City Heart
Studie, bei der mehr als 10.000 Menschen über viele Jahre erfasst und
untersucht wurden, zeigte sich, dass diejenigen, die entsprechende
Stress-Situationen hatten, eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit
auf Asthma, Heuschnupfen oder Neurodermitis hatten.
Wie kommt es, dass Konflikte und Stress direkt zu entzündlichen Prozessen in der Haut führen können?
Gieler: Das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir natürlich heute
immer ganz gespannt sind herauszufinden, wie denn eigentlich die
Gefühle und die Emotionen dann in der Haut landen und überhaupt wirksam
werden können. Das Stichwort hierzu lautet: Psychoimmunologie. Das heißt
also, die Beschäftigung mit den psychischen Reaktionen, die sich dann
immunologisch, also die Abwehrkräfte des Körpers betreffenden Zellen und
Organisationen, darstellen. Da gibt es sogenannte Nervenbotenstoffe,
die Neuropeptide. Und die interessieren uns besonders, weil wir schon
eine ganze Reihe von Jahren – also über zehn Jahre – wissen, dass es
ganz klare Nervenverbindungen gibt, die bis in die Haut hineinreichen.
An den Stellen, wo zum Beispiel Entzündungen der Hauterkrankungen
ablaufen – also der Schuppenflechte oder der Nesselsucht, der Urtikaria
oder der Neurodermitis – werden diese Neuropeptide aktiv. Durch die
direkten und engen Verbindungen der Nervenendigungen in der oberen
Hautschicht mit den Entzündungszellen das sind sogenannte dendritische
Zellen oder auch Langerhans-Zellen – kommt es zu einer Verstärkung oder
Abschwächung der Entzündungsreaktion unter Stresseinfluss.
Und jetzt muss man sich vorstellen, dass natürlich diese Zellen in der
Haut auf- und abwandern, wie so eine Polizei, die Streife geht und immer
aufpasst: Was passiert da in der Haut, um unsere Abwehr zu
gewährleisten? Und jetzt ist sozusagen ein Kontakt mit Nervenendigungen
da, der natürlich eine Stimmung, eine Emotion, ein schwerwiegendes
Lebensereignis zum Beispiel dann auch in die Haut als Information
weitertransportiert. Wir haben zwischen 5 und 40-50 Nervenendigungen pro
Quadratzentimeter Haut. Sehr viel eigentlich. Und dabei passieren
ständig immunologische Entzündungsprozesse. Wir nennen das in der
Wissenschaftssprache „neurogene Entzündung“. Das heißt also, ein
Nervenbotenstoff wird jetzt aus diesen Nerven freigesetzt, stimuliert
die Abwehrzelle und dadurch wird eine Entzündungsreaktion verstärkt oder
möglicherweise sogar ausgelöst.
Die Lebensqualität der Menschen, die an chronisch entzündlichen
Hauterkrankungen leiden, ist häufig massiv eingeschränkt. Ich möchte
über Tabu-Themen sprechen: Über Entstellung. Leiden chronisch hautkranke
Menschen unter Entstellungssymptomatik?
Gieler: Ja, natürlich, ganz sicher. Das ist auch zunächst einmal
völlig nachvollziehbar, wenn man sich vorstellt, man hätte einen
Ausschlag, der vielleicht sogar sichtbar ist am Körper oder
zumindestens, wenn ich ins Schwimmbad gehen will, sichtbar ist, dann
muss ich mir Gedanken machen, ob die anderen das anschauen, ob ich
vielleicht angesprochen werde. Und das führt natürlich zwangsläufig
dazu, dass Menschen mit einer entsprechenden Hauterkrankung – hier
möchte ich vor allem die Schuppenflechte nennen, weil die sehr
spezifisch mit Stigmatisierung zu tun hat, aber auch die
Weißfleckenkrankheit, die Vitiligo - Stigmatisierungsgefühle entwickeln.
Diese Stigmatisierungsgefühle können schließlich zu einer psychischen
Erkrankung führen, die wir soziale Phobie nennen. Der Rückzug aus
normalen Alltagssituationen und Alltagsgewohnheiten. Das ist am Beispiel
des Schwimmbads durchaus auch nachvollziehbar und verständlich, weil
die anderen Menschen ja dann nicht wissen: Ist das vielleicht nicht doch
ansteckend? Und dann wird der Bademeister angesprochen und dann wird
der Betreffende oder die Betreffende angesprochen. Und der oder dem ist
das natürlich dann peinlich und von daher kommt es dann zu einem
Wechselmechanismus. Und, wenn ich Menschen, die von einer
Schuppenflechte betroffen sind, frage, dann hat jeder von denen eine
solche Situation eigentlich schon mehrmals erlebt. Es ist
nachvollziehbar, dass man sich dann eher gerne zurückzieht. Die Zahlen
sprechen hier Bände: 30 - 40 Prozent der Menschen mit Schuppenflechte
ziehen sich zurück. Gehen auch nicht zum Frisör. Das ist schon sehr
eindeutig, so dass hier die psychischen Prozesse in der Folge einer
Hauterkrankung natürlich ganz wichtig sind.
Ich möchte noch ein bisschen tiefer in die psychischen Prozesse
einsteigen. Depressionen als Folge von Hauterkrankungen bis hin zum
Suizid, ist das ein Thema?
Gieler: Das ist auch ein Thema. Wir wissen, dass Suizidalität bei
Menschen mit Hauterkrankungen häufiger sind. Wir haben gerade in ganz
Europa eine Umfrage abgeschlossen im letzten Jahr, wo wir dieses Thema
aufgenommen haben. Die Ergebnisse zeigten, dass doch etwa 20 bis 25
Prozent aller Menschen mit chronischen Hauterkrankungen zu einer
Depression neigen. Das ist viel mehr als in der normalen Bevölkerung, in
der neun bis zehn Prozent an Depressionen leiden. Die Zahlen bei den
von Hautkrankheiten Betroffenen ist damit viel höher. Das Risiko, mit
einer Hauterkrankung eine Depression zu bekommen, steigt demnach auf das
1,5 bis 11-fache (z. B. bei Beingeschwüren = Ulcus cruris) an. Ebenso
ist es mit den Suizidgedanken, also den Gedanken eigentlich mit dieser
blöden Hauterkrankung nicht mehr leben zu wollen. Das betrifft auch etwa
zwölf Prozent und damit auch deutlich mehr, als in der normalen
Bevölkerung bekannt. Auch unsere Kontrollgruppe von Menschen, die in
Krankenhäusern arbeiten aber hautgesund sind, zeigen solche Suizidideen
deutlich seltener, aber mit 8 % auch nicht ganz selten! Bei der Frage:
„Gibt es die Suizidideen, weil Sie eine Hauterkrankung haben?“ antworten
von den Hautkranken immer noch insg. 4 % mit Ja! Es könnte ja auch
andere Gründe geben. Das heisst, es sagen immer noch über vier Prozent,
dass es nur an der Hauterkrankung liegt, warum sie suizidal sind. Und
das sind natürlich genau vier Prozent zuviel! Und in der Praxis sieht es
dann so aus, wenn diese Gedanken jede Woche vorkommen oder vielleicht
sogar jeden Tag, das bedeutet natürlich absolute Alarmstufe, weil dann
etwas vorhanden ist, was sofort auch psychotherapeutisch/psychiatrisch
behandelt werden muss.
Welche Chance bietet die Psychodermatologie Menschen mit chronisch entzündlichen Hauterkrankungen?
Gieler: Die Psychodermatologie kann insofern schon mal sehr
hilfreich sein, weil sie in der Lage ist, die Prozesse, die psychisch
bei Menschen mit Hauterkrankungen vorhanden sind, zu verstehen. Wenn ich
etwas besser verstehe, dann kann ich auch besser damit fertig werden
oder damit umgehen. Und es ist schon ein großer Unterschied, ob jetzt
ein Arzt vor einem sitzt und einfach nur nachschaut, wie die Symptome
sind und ein Rezept schreibt und sagt: Das und das müssen Sie machen...
Oder ob jemand das auch noch hinterfragt und nachfragen kann und
versteht, z. B. die Stigmatisierung versteht, warum die psychische
Spannung sich auch in der Haut äußert, das ist dann für viele Menschen
durchaus erleichternd, weil sie dann merken, dass sie sich das nicht
einbilden, dass sie nicht das Gefühl haben müssen, keiner versteht sie
eigentlich, sondern, dass diese Dinge bekannt sind. Das ist schon mal
sehr hilfreich. Außerdem ist es natürlich so, dass wir in der
Komplexität der heutigen Psychotherapiemethoden und der
Psychotherapieforschung ein ganzes Arsenal von Techniken, von
Möglichkeiten zur Verfügung haben, die eben psychotherapeutisch
angewendet werden können. Angefangen von Entspannungsmethoden. Hier gibt
es nicht nur das Autogene Training und die Progressive
Muskelentspannung, sondern heute auch Achtsamkeit und Yoga, Pilates als
weitere Methoden. Dann in der Psychotherapie gibt es auch sehr gute
Entwicklungen zu spezifischen Traumabehandlungen oder zu spezifischen
Ansätzen bei der sozialen Phobie, bei der ein manualisiertes
Trainingsprogramm im psychodynamischen Sinne entwickelt wurde. Wir haben
spezielle Programme für Menschen mit Entstellungsgefühlen, der
sogenannten körperdysmorphen Störung. Und wir haben natürlich auch in
dem Spektrum, zum Beispiel der Borderlinebehandlung, spezifische
Therapieansätze, die erst in den letzen 15 bis 20 Jahren entwickelt
wurden und die viel besser greifen, als das vorher der Fall war.
Kann ich, wenn ich die Psychodermatologie in Anspruch nehmen möchte, mit einer Unterstützung der Krankenkassen rechnen?
Gieler: Ja, insofern, als die Psychotherapie in Deutschland ja
eine klare Kassenleistung ist, die zwar über ein sogenanntes
Antragsverfahren läuft, aber trotzdem eine Kassenleistung bleibt! Jede/r
niedergelassene Psychotherapeut/in kennt diese Wege und wird nach einem
Erstgespräch die formale Notwendigkeit für einen Gutachter der
Krankenkasse schriftlich darstellen. Hier gibt es psychologische
Psychotherapeuten, die ebenso mit der Kasse abrechnen können wie auch
ärztliche Psychotherapeuten, die Fachärzte sind für Psychosomatik und
Psychotherapie oder ein Psychiater, der auch psychotherapeutisch tätig
ist. Alle diese Berufsgruppen können, dürfen und müssen bei der Kasse
einen Antrag stellen, um eine Psychotherapie durchzuführen. Dann kommen
natürlich auch noch die psychosomatischen Rehabilitationskliniken dazu,
die auch nicht ganz wenig Betten in Deutschland haben, immerhin über
16.000. Wir haben auch hier vielfältige Möglichkeiten. Das Problem ist
eigentlich nur, dass es angesprochen werden muss, dass die Information
da sein muss und dass eben dann auch die Anträge gestellt werden müssen.
Kann ich die Psychodermatologie als „Balsam für Haut und Seele“ bezeichnen?
Gieler: Das habe ich bisher zwar selber noch nicht getan, aber das
finde ich eine gute Idee. Ähnlich wie das ja auch mit Massagen ist, die
ja nun ganz konkret die Haut berühren und die ja bekannterweise bei
Depressionen durchaus helfen, denke ich, dass die Psychodermatologie
tatsächlich ein bißchen Balsam auf der Seele der kranken Haut ist.
Sehr geehrter Herr Professor Gieler, wir danken Ihnen für das Gespräch und für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben!
 Buchtipp: Die Sprache der Haut, Uwe Gieler, Patmos Verlag
Unser Gesprächspartner:
Buchtipp: Die Sprache der Haut, Uwe Gieler, Patmos Verlag
Unser Gesprächspartner:
Univ. - Prof. Dr. med. Uwe Gieler
Komm. Leiter der Universitäts-Hautklinik am UKGM Giessen
Rudolf-Buchheim-Straße 8 , 35392 Gießen
Web:
http://www.ukgm.de/ugm_2/deu/ugi_pso/index.html
E-Mail:
uwe.gieler@psycho.med.uni-giessen.de
Moderatorin:
Sonja Kohn
Heilpraktikerin/Dozentin/Freie Redakteurin/Ein Mitglied der AG Haut.
Peiner Str. 29, 31319 Sehnde, Tel.: 05138 – 61 57 52
www.naturheilpraxis-kohn.de
http://sonjakohn.blogspot.de/
http://psyche-kompakt.blogspot.de/
Jeden 1. Montag im Monat auch als Radiomoderatorin auf Radio Leinehertz 106.5, 17:05 Uhr.
www.leinehertz.net/


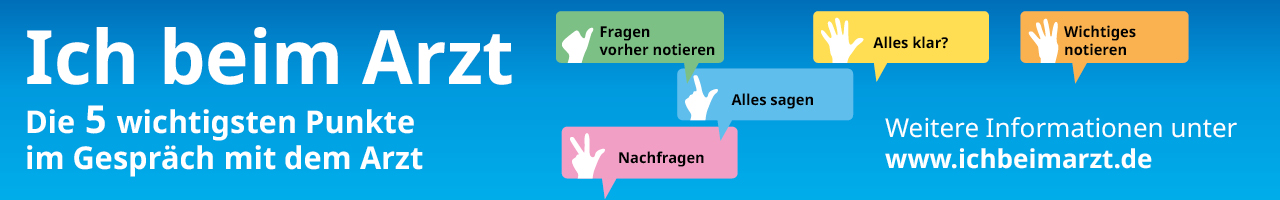



 Die
Haut: Mit 1,5 bis 2 qm ist sie das größte Organ unseres Körpers. Haut
und Nervensystem werden aus dem gleichen Keimblatt „geboren“. Ist das
ein Grund dafür, dass die Haut als Spiegel unserer Seele gilt?
Die
Haut: Mit 1,5 bis 2 qm ist sie das größte Organ unseres Körpers. Haut
und Nervensystem werden aus dem gleichen Keimblatt „geboren“. Ist das
ein Grund dafür, dass die Haut als Spiegel unserer Seele gilt?  Buchtipp: Die Sprache der Haut, Uwe Gieler, Patmos Verlag
Buchtipp: Die Sprache der Haut, Uwe Gieler, Patmos Verlag